
(559)
3. Der Tod aller Mütter oder Ulane und Zouave
4. Delila, Helden und Glück
3. Der Tod aller Mütter oder Ulane und Zouave
Zwei verhängnisvolle Ereignisse sollten Mays Romanentwürfe gänzlich durcheinanderbringen. Seine Mutter litt an einer Geschwulst (556), die von Tag zu Tag lebensbedrohlicher wurde; schon warf der Tod seinen Schatten voraus. Von bösen Vorahnungen getrieben, schrieb May Anfang März 1885 folgende Zeilen für den Verlornen Sohn nieder:
Da erklang es unter einem Schluchzen, wie
Engelchen es in ihrem ganzen Leben noch nicht gehört hatte:
»Todt! Todt! Meine Mutter ist todt!«
»Tröste Dich! Sei ruhig! Sie ist gut aufgehoben!«
»Meine Mutter! Meine liebe, liebe, gute Mutter! … Meinetwegen
ist
sie gestorben!« (557)
Bei der Niederschrift dieser Szene, welche das Gespräch zweier Mädchen im Gefängnis wiedergibt, stand zunächst Mays eigene Situation im November 1868 Pate. Während er eine Haftstrafe in Schloss Osterstein verbüßte, starb seine Großmutter väterlicherseits. Diese Frau war für May viel mehr als nur eine Großmutter, um so härter traf ihn der Verlust. In seiner Selbstbiographie legt er hiervon Zeugnis ab:
Ich grüßte gar nicht und fragte, wo Großmutter sei. »Tot – – – gestorben!« lautete die Antwort. »Wann?« »Schon voriges Jahr.« Da sank ich auf den Stuhl und legte Kopf und Arme auf den Tisch. Sie lebte nicht mehr! Man hatte es mir verschwiegen, um mich zu schonen, um mir die Gefangenschaft nicht noch zu erschweren. Das war ja recht gut gedacht; nun aber traf es mich um so wuchtiger. Sie war nicht eigentlich krank gewesen; sie war nur so hingeschwunden, vor Gram und Leid um – – – mich! (558)
Diese bittere Erinnerung überfiel May wie ein Angstgespenst.
Jetzt sollte er zum zweiten Male eine Mutter verlieren! Der 5. April war
Ostersonntag. Möglicherweise benutzten Karl und Emma die Feiertage zu
einem Krankenbesuch. Am darauffolgenden Samstag waren sie mit Sicherheit
bei der Mutter in Ernstthal, denn sie beging dort ihren achtundsechzigsten
Geburtstag, und von diesem Zeitpunkt an dürfte Karl May ständig bei seiner
Mutter gewacht haben. Nur vier Tage später wird Christiane Wilhelmine May
von ihrer schweren Krankheit erlöst.
»Als seine Mutter in seinen Armen starb, hielt er sie vom Abend bis zum Morgen als Leiche in seinen Armen. Handelt so ein uns normal erscheinender Mensch? Das Grab der Mutter wurde doppelt tief gemacht. Er wollte bei ihr begraben werden.« (560)
Mays zweite Ehefrau Klara schrieb diese wichtige Aufzeichnung »in einem flüchtig skizzierten Aufsatz« nieder. (561) An den Wahrheitsgehalt ihrer Worte, die ersichtlich auf Mitteilungen ihres Gatten beruhen, ist nicht zu zweifeln. Der Tod seiner Mutter traf May wie ein fürchterlicher Schlag auf den Kopf:
Ich war gestorben; ich besaß keinen Körper mehr; ich war nur Seele, nur Geist. Ich flog durch ein Feuer, dessen Gluth mich verzehren wollte, dann durch donnernde Wogen, deren Kälte mich erstarrte, durch unendliche Wolken- und Nebelschichten, hoch über der Erde, mit rasender, entsetzlicher Schnelligkeit. Dann fühlte ich nur, daß ich überhaupt flog, grad so, wie der Mond um die Erde wirbelt, ohne einen Gedanken, einen Willen zu haben. Es war eine unbeschreibliche Leere um mich und in mir. Nach und nach verminderte sich die Schnelligkeit. Ich fühlte nicht nur, sondern ich dachte auch. Aber was dachte ich? Unendlich dummes, ganz und gar unmögliches Zeug. (562)
Eindringlicher konnte May seinen Seelenzustand gar nicht beschreiben. Noch heute kann man aus seinen Worten die Ohnmacht und Verzweiflung spüren, die er empfand, als seine Mutter starb. Der letzte Ritt, aus dem diese Sätze stammen, erweist sich als wahre Fundgrube, wenn es darum geht, Licht in das Dunkel jener Tage zu bringen:
Die Mutter lebte noch, als ich nach Mekka pilgerte. Sie starb, und kurze Zeit später traf den Vater der Schlag. Jetzt kann er kein Glied bewegen und auch nicht sprechen, sondern nur lallen; dennoch betet er ohne Unterlaß, daß Allah ihn erlösen möge, damit er mir nicht länger zur Last falle. Ich aber bete heimlich zu der großen Muhabbet ilahi (Göttlichen Liebe), ihn mir noch lange, lange zu erhalten. Vater und Mutter hat man nur einmal. Sind sie gestorben, so hat der Mezarlyk den besten Theil des Kindes empfangen, und keine Seele auf Erden meint es mit ihm wieder so gut und treu, wie die Hingeschiedenen. (563)
Den Äußerungen des Buchhändler Ali aus Kabatsch können wir eine äußerst wichtige Information entnehmen: kurze Zeit später traf den Vater der Schlag. Dieses Ereignis müsste demzufolge zwischen dem 15. April 1885 und dem Zeitpunkt der Niederschrift etwa Anfang August 1885 eingetreten sein, aber der Schlaganfall lässt sich viel genauer zeitlich bestimmen. Begleiten wir den Buchbinder Heilmann in die Residenzstadt:
»Der Schlag getroffen - den guten Alten - oben liegt er
unter dem Dache! …«
… Er stieg die Treppe empor und dann die Oberbodentreppe.
Da, unter dem Dache, stand ein Bett. In demselben lag der Kranke. Die
Lumpen, welche ihn bedeckten, waren nicht Betten zu nennen. Zwischen
den Ziegeln hatte es hereingeschneit; der Schnee lag fußhoch auf der
halbverfaulten Diele. Es war schrecklich! Der Kranke konnte sich nicht
bewegen; er konnte auch nur langsam und mit Anstrengung sprechen. Er
sah wie eine Leiche aus: das graue Haar verwirrt und die Wangen
eingefallen. Als der Alte den Kommenden erkannte, glitt ein Zug der
Freude über sein Gesicht.
»Wilhelm!« stieß er hervor.
»Pathe, mein lieber Pathe! Wie finde ich Sie wieder!«
Mit diesen Worten trat er an das Bett, um die Hände des
Alten zu erfassen. Sie waren schwer und eiskalt. Dem Kranken traten
dicke Thränen in die Augen. Er war nicht im Stande, sie wegzuwischen.
»Ich wollte, ich wäre todt!« flüsterte er. (564)
Dieser Text wurde im Juni 1885 für den Verlornen Sohn verfasst. Somit trat der Schlaganfall im Mai ein, und dass er wirklich stattfand, daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen:
Nämlich in einem Hinterhause des Altmarktes, drei Treppen hoch klebte an einer der vielen Stubenthüren eine Karte mit der Bezeichnung »Max Holm, Reporter«. In dem Zimmer hinter der Thür war es recht still. In einem alten Lehnstuhle saß ein schlafender Mann, dessen gelähmter und geschwollener Körper mittelst eines Tuches fest an die Lehne gebunden war.
Dreißig Zeilen später fallen die entscheidenden Worte:
»Dann kam das doppelte Unglück.«
»Ihr armen Leute! Wie kam denn das Alles?«
»Nun, Mutter wurde krank und starb; dann wurde der Vater
vom Schlage gelähmt. …« (565)
Neben den Lähmungserscheinungen tritt fortan ein seltsames Phänomen in sämtlichen Schriften Mays auf: das Sterben aller Mütter! So stellte Walther Ilmer die berechtigte Frage: »Warum stirbt Ida?«
»Im Brief an ›Bertha‹ bestellt Richard von Königsau Grüße an ›Mama‹ [D.W., Lfg. 6, S. 92]. Bald darauf bemerkt er: ›Mama war Französin‹ [D.W., Lfg. 77, S. 1219], und seinem soeben geretteten, auf den Tod schwachen Vater ersparen er und Emma nicht die grausame Nachricht, Ida sei ›vor kurzem gestorben‹ [D.W., Lfg. 99, S. 1575], Hier handelte Karl May schier unbegreiflich – denn warum wird Ida vom späten Familienglück ausgeschlossen und Gebhardt unnötig hart belastet?« (566)
Die Frage Walther Ilmers beantwortet sich praktisch von selbst, wenn man das Augenmerk auf einige prägnante Textstellen Mays richtet, die er kurz nach dem Tode seiner Mutter verfasst haben muss:
» Hast Du Verwandte daheim?«
»Ja, Herr Major,« antwortete sie leise, als ob sie sich
scheue, ihre Stimme hören zu lassen.
»Was für welche?«
»Den Vater und einen Bruder.«
»Hier habe ich Deine Haus- und Einlieferungsacten, aus
denen ich ersehe, daß Dein Vater Brand heißt und Forstwärter ist. …«
Im Mittelpunkt des Geschehens steht Bertha Brand, eine junge Sklavin der Schande, ohne Obdach und Nahrung, von ihrem Geliebten ausgenutzt und im Stich gelassen. Als sie ein Kind bekommt, rauben ihr die Schmerzen der Geburt den Verstand und leiten ihre Hände zum verhängnisvollen Griff – das unschuldige Kind lag erwürgt vor ihren Füßen.
»Ich habe bereut und gebüßt. In mehr als zweitausend Nächten habe ich auf meinem harten Lager mit dem Bewußtsein meiner Schuld gekämpft, welches mich immer und immer wieder in die fürchterliche Versuchung führte, auch meinem Leben ein Ende zu machen. Der Gedanke an Gott und meinen alten Vater hat mich davon abgehalten.« (567)
Der Gedanke an meinen alten Vater, das ist hier wichtig. Von einer Mutter ist nicht die Rede, wie sollte denn auch? Mays Mutter war ja soeben am 18. April beerdigt worden. Mit der Bertha-Brand-Episode hat es eine besondere Bewandtnis. Unter dem Titel Ulane und Zouave erschien sie in den Lieferungen 88–91 der Münchmeyer-Zeitschrift ›Deutscher Wanderer‹, und zwar als zehntes Kapitel in dem Hauptroman Die Liebe des Ulanen.
In diesem Roman ist der Text ein Fremdkörper. Sowohl vorher als auch nachher hat er mit den Ulanen überhaupt nichts zu tun. Deswegen wurde er in sämtlichen späteren Buchfassungen fortgelassen. Lange Zeit herrschte sogar die Meinung vor, er sei gar nicht von May, sondern von jenem August Walther, Münchmeyers Faktotum, verfasst worden.
Claus Roxin gebührt das Verdienst, frühzeitig durch biographische Spiegelungen nachgewiesen zu haben, dass dieser Text sehr wohl von May stammt. (568) Die Handlungselemente in Ulane und Zouave sind: Kindesmord, Zuchthaus sowie Pfandleiher und Wechselgeschäfte; genau dieselben Elemente befinden sich auch in dem Lieferungsroman Der verlorne Sohn.
Dieser Roman startete bekanntlich mit der Schlusslieferung des Waldröschen und lief dann von Woche zu Woche parallel mit den Ulanen im ›Deutschen Wanderer‹. Um das Rätsel Ulane und Zouave lösen zu können, muss man sich intensiv mit den Laufzeiten beider Lieferungswerke beschäftigen. Bedeutsam sind:
›Deutscher Wanderer‹, Lfg. 87, Samstag, 13. Juni 1885
Ohne Ulanen-Fortsetzung!
Die Liebe des Ulanen, Lfg. 88, Samstag, 20.
Juni 1885
10. Ulane und Zouave.
Der verlorne Sohn, Lfg. 41, regulär
Samstag, 30. Mai 1885
Dritte Abtheilung. Die Sclaven der Schande, 1. Ein
Magdalenenhändler.
Man weiß, wie sehr May unter dem Tode seiner Mutter zu leiden hatte. Am liebsten wäre er gleich mit ihr begraben worden! Seine Schaffenskraft erlahmt, nur mit großer Mühe rafft er sich nach ihrer Beerdigung auf und schreibt weiter. Als ›verlorener Sohn‹ schleppt er sich über die Manuskriptseiten dahin. Todessehnsüchte peinigen ihn. Seine Mutter hat ihn für immer verlassen. Darf das Kind noch leben?
Tief in derartigen Gedanken versunken, beendet der ›verlorene Sohn‹ die zweite Abteilung Die Sclaven der Arbeit:
In der Nacht hörte der Todtengräber ganz
eigenthümliche Töne. Er weckte seine Frau.
»Horch! Was ist das?«
»Ein kleines Kind schreit.«
»Aber auf dem Gottesacker? Da ist Etwas passirt!
Brenne die Lampe an! Wir müssen nachsehen!«
Die beiden Leute kannten keine Furcht. Die
Kinderstimme war zwar verstummt, aber sie durchsuchten dennoch den
Kirchhof. Auf dem Grabe des Beyer’schen Ehepaares lag die Tochter
ohne Besinnung, in ihrem Schooße ein kleines Kind. Ihre Hände
waren fest um den Hals des zarten Wesens gekrallt – das Kind war
zwar noch warm aber leblos.
Der Todtengräber und seine Frau schafften die
ohnmächtige Mutter und das todte Kind zu sich in die Stube. Dann
ging der Erstere zum Gemeindevorstand, um diesen zu wecken und
Meldung zu machen. Wegen der vielen auf dem Schachte Verunglückten
befanden sich zwei Aerzte im Orte. Zu ihnen gesellte sich am
Morgen der Gerichtsarzt. Die Drei begaben sich in das Haus des
Todtengräbers, um das Kind zu untersuchen.
Auguste Beyer lag still und theilnahmslos im Bette.
Die Aerzte erklärten, das Kind habe nach der Geburt gelebt und
geathmet und sei erdrosselt worden.
»Haben Sie das gethan?«
Sie nickte mit dem Kopfe. Sollte sie etwa leugnen? Es
war ja nun doch Alles gleich.
Bereits am Nachmittage zog sie als Kindesmörderin
wieder in das Untersuchungsgefängnis ein, welches sie gestern
verlassen hatte. Die Aerzte hatten begutachtet, daß sie
transportabel sei, wenn man die nöthige Vorsicht anwende. Sie
sagte kein Wort, und sie weinte auch nicht. Warum auch weinen? Es
war nun doch Alles aus! – (569)
–
Dritte Abtheilung.
Die Sclaven der Schande.
[Ulane und Zouave]
Es war Mittag, die Stunde, in welcher der gewöhnliche Bürger seine Hauptmahlzeit einzunehmen pflegt. Darum zeigten sich die sonst so belebten Straßen der Stadt [Rollenburg] ziemlich menschenleer, und selbst auf dem Marktplatze erblickte man nur einen einzigen Menschen, welcher auf ein Haus zuschritt, dessen Aeußeres darauf schließen ließ, daß die Bewohner zu den sogenannten besseren Ständen zu rechnen seien. … (570)
Der verlorne Sohn verselbständigt sich. Ohne Rücksicht auf den laufenden Abdruck des Ulanen in der Zeitschrift ›Deutscher Wanderer‹ zu nehmen, schreibt May einfach weiter. Es war ja nun doch Alles gleich. Das noch vorhandene Manuskript für Die Liebe des Ulanen schrumpft dahin. Jäh setzt die Zäsur ein:
Lieferung 87
Deutscher Wanderer
Fortsetzung des Romans Die Liebe des Ulanen erscheint in der
nächsten Nummer. (571)
Was war geschehen? Im Mai 1885 dürfte May die Arbeit am Ulanen-Manuskript eingestellt haben. Er arbeitete in der Regel zwei bis drei Wochen im voraus. Dies war unbedingt nötig, wollte man nicht auf die passenden Bilderbeilagen pro Lieferung verzichten. Freilich gab es im ›Deutschen Wanderer‹ im Gegensatz zu den Lieferungsromanen keine Textillustrationen, dennoch war auch hier, wegen der verschiedenen Autoren, eine gewisse Vorplanung gefordert. In einem Brief an seinen Prokuristen Rudolf Jäger vom 14. März 1885 klagt Münchmeyer darüber, dass »May nicht dazu zu bewegen sei, wöchentlich mehr als eine Nummer zu liefern.« (572)
Demnach war May zwar darum bemüht, einen zwei bis dreiwöchigen Vorsprung zu halten, doch er überschätzte seine Kräfte insofern, als er eine längere Unterbrechung seiner Schreibarbeit völlig ausschloss und kontinuierlich genau so viel schrieb, wie es die augenblickliche Situation erforderte. Mit der Lieferung 86 bricht schließlich die Ulanen-Fortsetzung ab. Ursächlich ist die weitere familiäre Tragödie:
[Die Mutter] starb, und kurze Zeit später traf den Vater der Schlag. (573)
Diese Schreckensnachricht wurde wahrscheinlich
telegrafisch nach Dresden übermittelt. May musste mit dem
Schlimmsten rechnen. Schockiert über diesen neuen Schicksalsschlag
dürfte er am Ende seiner Kräfte gewesen sein, konnte zunächst
nicht einschätzen, wann er als Autor wieder Zeit und Ruhe zum
kreativen Schreiben fand. Das Manuskript für den Ulanen-Roman
geht zur Neige. Ein weiteres pünktliches Erscheinen der
Zeitschrift ›Deutschen Wanderer‹ ist nicht gesichert. Besonderes
problematisch ist laut Titelkopf die rechtzeitige Auslieferung
nach »Oesterreich-Ungarn [am] 1., 10. und 20. jeden Monats 1
Heft«. – Karl May, der in Ernstthal bei seinem Vater sein will,
reagiert verständlicherweise panisch und impulsiv, auch liegen
gewiss bei Münchmeyer die Nerven blank. Der ursprüngliche Anfang
von Die Sclaven der Schande, das sogenannte
Bertha-Brand-Fragment, wird nicht für den verlornen Sohn
gedruckt, sondern wandert buchstäblich mit kleinen Anpassungen in
den ›Wanderer‹, der Vorrang hat. Notgedrungen muss Karl May die 3.
Abteilung anders als beabsichtigt beginnen, für die noch ein
kleiner Manuskriptteil nach einem Szenenwechsel vorliegt, jedoch
nicht ausreichend für eine weitere Lieferung. Offenbar ist May
physisch nicht in der Lage, sich zeitnah um die Fortsetzung zu
kümmern.
Für das vorhandene Bertha-Brand-Manuskript wählt Karl May die unpassende Kapitelüberschrift: 10. Ulane und Zouave. Keinesfalls ist aber, wie sollte es auch, in dem eingeschobenen Zwischentext von Ulanen und Zouaven die Rede. Erst mit Lieferung 102, der Algier-Episode, gewinnt die Kapitelüberschrift durch Ausbruch des deutsch-französischen Krieges minimal an Bedeutung. Bis zur Algier-Episode verlangt das Thema noch den Titel des vorherigen Kapitels Zum Kriege drängend.
Die Kriegsvorbereitungen erreichen nämlich mit der Pulverlieferung nach Schloss Ortry in Lieferung 93 ihren ersten Höhepunkt. Der Grund für die ungewöhnliche Kapitelüberschrift muss also anderswo gesucht werden. Hatte May vielleicht beabsichtigt, die neuen Handlungselemente des Zwischentextes mit dem Ulanen-Roman zu verknüpfen? Wohl kaum, das war rein technisch gar nicht mehr möglich.
Der Roman war offenkundig auf 104 Lieferung begrenzt, dies entsprach einer Laufzeit von exakt zwei Jahren. Erst in der Lieferung 102 erfährt der Leser von einer Änderung:
Mit der Nummer 105 resp. 106 schließt die Zeitschrift: »Deutscher Wanderer« den 8. Band, sowie überhaupt ihr Erscheinen vollständig. Um dem in gegenwärtigem Band enthaltenen Roman: »Die Liebe des Ulanen« einen für die geehrten Leser genügenden und würdigen Abschluß zu geben, wird es nöthig, den vorliegenden Band dieser Zeitschrift bis mit Nummer 105 resp. 106 erscheinen zu lassen. (573)
Das Schlussmanuskript kann zu diesem Zeitpunkt nicht lückenlos vorgelegen haben, denn gegen alle Erwartungen wurden es sogar 108 Lieferungen. Demnach fiel es May nicht leicht, den Roman auf angemessene Weise zu beenden. Eine Integration des Ulane und Zouave-Zwischentextes hätte eine stattliche Anzahl weiterer Lieferungen erforderlich gemacht und wäre zweifellos am Thema des Gesamtromans vorbeigegangen.
Somit stellt sich noch immer die Frage: warum heißt der Zwischentext Ulane und Zouave? Ein zwei Jahre später stattfindendes Wortspiel des Hobble-Frank bringt die Lösung. Nach einem Stinktier-Malheur verbreitet ein ›Neger‹ namens Bob infame Gerüche:
»Das riecht doch noch viel schlimmer, als ob
hier eene geschtorbene Leiche nich richtig eingescharrt worden
wäre! Oder – – hm!«
Er blickte sich um und gewahrte den Schwarzen,
welcher hinter dem Baume lehnte, unter welchem der Sachse saß.
»Willst du gleich fort, du Sakkerment!« schrie er
ihn an. »Wie kannst du dich da an meinen Boom randrücken! Denkst
du etwa, ich habe meine Nase vom Maskenverleiher geborgt? Geh
fort, Zuave, und konzentriere dich nach Afrika! Unsere Nerven
aber sind zu sehre kultiviert für dich. Nelken, Reseda und
Blümelein, Vergißmeinnicht, das lass’ ich mir gefallen. Aber
Skunk mag ich selbst der feinsten Dame nich ins smelling-bottle
raten!« (574)
Wie fast immer findet der Hobble-Frank für das, was er eigentlich meint, nicht die richtigen Worte. (575) Der Zuave, Angehöriger einer aus Berberstämmen rekrutierten französischen Kolonialtruppe, ergibt als Beschimpfung keinen Sinn. Geh fort, Sklave, und konzentriere dich nach Afrika muss es eigentlich dem damaligen Zeitgeist entsprechend heißen. Aber May war für die damalige Zeit viel zu humanistisch gesinnt, dass ihm dies durch den Hobble-Frank entfahren wäre; er gebrauchte deshalb abermals ein passendes Wortspiel: Zuave für Sklave.
Ulane und Z o u a v e
Sc (l) a v e
Mays Faible für das Wortspiel trägt tragikomische Züge. Die Liebe des Ulanen und Die Sclaven der Schande – zwei Romane ineinander gefügt. In symbolischer Manier schickt er das jüdische Pfandleiherehepaar Salomon und Rebecca Levi nach Algier, obwohl sie in der Residenzstadt des Verlornen Sohn eigentlich besser aufgehoben wären; sie wandern quasi von einem Roman in den anderen hinein.
Der Schlüsselsatz im Zouave-Text lautet:
Der Sclave ist ein Fürst geworden, und Die, welche ihn verachten, werden seine Sclaven sein. (576)
Hiermit ist im übertragenen Sinne Gustav Brandt – der Fürst von Befour – gemeint, und es ist nicht uninteressant zu erfahren, welche Gestalt Der verlorne Sohn angenommen hätte, wenn der Zouave-Text dort verblieben wäre. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens ist sowohl in der früheren als auch in der späteren Fassung das Zuchthaus (G)rollenburg.
Dort lag ein mehrere Stockwerke hohes, aus
starken Quadersteinen aufgeführtes Gebäude, oder genauer gesagt,
ein Gebäudecomplex, welcher einige finstere Höfe umschloß und
von einem Garten umgeben wurde, welchen eine Mauer von der
Außenwelt trennte. … Sämtliche Fenster des ernsten Bauwerkes –
ein Schloß aus alter, alter Zeit – waren mit starken, festen
Gittern, viele auch noch obendrein mit blechernen Kästen
versehen, welche sich nur nach oben öffneten und also einem
spärlichen Lichtstrahl den Eingang erlaubten …
Dieses alte, finstere Schloß diente als Wohnung
Solcher, welche gegen die bestehenden Gesetze gesündigt hatten –
es war das Zuchthaus zu Grollenburg. Dieser Name hatte sich in
den Sprachgebrauch des Landes so eingebürgert, daß »nach
Grollenburg kommen« ebenso viel hieß wie Insasse des Zuchthauses
werden. (577)
Die Stadt Rollenburg hatte ihren Namen von dem
Schlosse erhalten, welches sich über ihr auf dem Felsen erhob.
Die Rollenburg war im dreizehnten Jahrhundert erbaut worden …
Spätere Besitzer hatten sie vergrößert. Mehrere Flügel waren
nach und nach angebaut worden, und als sie schließlich in
fiscalischen Besitz überging, machte man aus den weiten Hallen
und Sälen enge Zellen … Die größere Hälfte des Schlosses wurde
in ein Zucht- und die kleinere in ein Irrenhaus umgewandelt.
Seit dieser Zeit hieß, nach Rollenburg kommen,
nichts Anderes als in’s Zucht- oder in’s Irrenhaus kommen.
(578)
Die Umbenennung von Rollenburg in Grollenburg erwies sich als notwendig, weil es offenbar Abonnenten gab, die beide Romane bezogen. Und hierin findet man einen weiteren sicheren Beleg, dass Münchmeyer mit dieser Textmanipulation auf gar keinen Fall zu tun hatte.
Das Wetter entlud sich in ungewöhnlicher Macht über der Gegend; Blitz folgte auf Blitz und das Grollen des Donners rollte ohne Aufhören fort. (579)
Töne, dumpf rollend wie Erdbeben, grollend und zürnend wie hohler Donnerschall, … (580)
Jetzt machte sich das Nahen der Wagen durch ein immer vernehmlicher werdendes Rollen bemerklich, welches nach und nach zu einem Geräusche anwuchs, das dem Grollen eines entfernten Donners glich. (581)
Man sieht, nur Karl May konnte auf den Gedanken verfallen mit einem Groll, ausgerechnet Rollen(burg) durch Grollen(burg) zu ersetzen. Während er vor dem Rollen ein ›G‹ stellte, entfernte er bei Bertha Brand(t) das ›T‹. Sie könnte ursprünglich die Kusine Gustav Brandts gewesen sein. Als Fürst von Befour hätte er Bertha vor den Intrigen des Premierleutnant Franz von Wilden in Schutz genommen.
Im Verlornen Sohn wurde Bertha Brand(t) durch Laura Werner ersetzt. Ebenso verfuhr May mit Franz von Wilden, – er ist der Ur-Bruno von Scharfenberg. Keinen Ersatz gab es für den in (G)rollenburg lebenden Juden Baruch Silberglanz nebst Familie.
»Habe ich nicht Recht, Sulamithleben? Habe ich nicht Recht, Gamaliel, mein Sohn?« meinte der Alte, ein begonnenes Thema fortsetzend. … »Wir wurden verachtet, verfolgt und getödtet. Unser Blut floß in Strömen … Das Licht des Tages war uns verboten …; darum arbeiteten wir im Dunkel der Nacht. Wir durften nicht Bürger werden; wir durften kein Haus, kein Feld, kein Stückchen Landes kaufen, welches so groß ist, wie der Teller meiner Hand. Da blieb uns nur der Handel offen …; wir hungerten, aber wir arbeiteten und sparten … Man sperrte uns in besondere Gassen, uns, den Abschaum der Gesellschaft; wir aber hatten in unseren Truhen Gold und Silber in Menge … Wir zahlten ungeheure Steuern, aber wir nahmen noch größere Zinsen. … Die Macht des Goldes erzwang uns endlich Gleichberechtigung, und nun konnten wir den offenen Kampf beginnen …« (582)
Es ist bedauerlich, dass May auf diese bemerkenswerte, soziologische Textpassage im Verlornen Sohn verzichtete. Mit Recht spricht Claus Roxin von einem revolutionären Pathos der Unterdrückten, aus dem die gesellschaftliche Lage der Juden erklärt wird. (583) Funktionen, die Baruch Silberglanz in (G)rollenburg inne hatte, werden später auf Salomon Levi übertragen. So schließt sich der Kreis um Ulane und Zouave. Übrig bleibt ein außergewöhnliches Fragment, das vom literarischen Gehalt höher einzuordnen ist als die endgültige Fassung im Verlornen Sohn. Der Tod von Christiane Wilhelmine May hat somit unauslöschliche Spuren hinterlassen:
»Ist Ihnen das alte Lied bekannt:
Wenn sich
zwei Herzen scheiden,
Die sich
dereinst geliebt,
Das ist
ein großes Leiden
Wie
größer keines giebt?«
»Ich habe es oft gesungen.«
»Schön! Singen Sie es, so oft Sie wollen; aber
erleben Sie es nicht! Wie schlimm das ist, das habe ich sehr,
sehr oft an mir erfahren, mein Lieber!« (584)
Diese beeindruckenden Worte lesen wir sogleich in der ersten Lieferung des von May endlich fortgeführten Romans Die Liebe des Ulanen. Ebenso dramatisch sind die Dialoge im Verlornen Sohn gehalten:
» Darf ich fragen, was Ihr Vater ist?«
»Er ist Holzschnitzer. … Leider aber kann er das
Geschäft nicht mehr treiben. Er ist in die Kreissäge gekommen
und hat dabei drei Finger der rechten Hand verloren.«
»O weh! Das ist schlimm! Da bedaure ich ihn von
Herzen. Nun wird Ihre arme Mutter doppelt arbeiten müssen!«
Es flog ihr feucht über die Augen, als sie
antwortete:
»Ich habe keine Mutter mehr. …« (585)
Für den Schriftsteller Karl May beginnt eine schwere, arbeitsreiche Zeit. Er muss seine Arbeitsschulden abtragen. Um des Vergessens willen geht er mit fieberhaftem Fleiß ans Werk. Hierbei fließen seine Texte immer mehr ins Autobiographische, und einmal ist May derart erschüttert, dass er den Handlungsfaden einfach abbricht.
Der Buchbinder Heilmann hatte von seinem Paten eine Taschenuhr käuflich erworben, und als dieser dann infolge eines Schlaganfalls verstirbt, wird Heilmann aufgrund einer falschen Anschuldigung inhaftiert. Über das weitere Schicksal Heilmanns hüllte sich der Autor in geheimnisvolles Schweigen.
Der Sachkundige weiß, dass eine ebensolche Uhren-Affäre May in jungen Jahren zum Verhängnis wurde. Wenige Wochen nach dem Tode seiner Mutter fühlte sich der Autor nicht dazu in der Lage, die Heilmann-Episode positiv enden zu lassen, weil die Uhren-Affäre in der Realität einst soviel Unglück über die Familie Mays gebracht hatte.
Noch den Tod seiner Mutter vor Augen, musste Karl May zunächst stündlich mit dem Ableben seines schwerkranken Vaters rechnen. Er mag hierbei an den Großvater seiner Ehefrau Emma gedacht haben, der fünf Jahre zuvor ebenfalls im Monat Mai einen Schlaganfall erlitt und an den Folgen wenig später verstarb. (586)
Im Verlornen Sohn trugen Mays düstere Vorahnungen bittere Früchte, indem er den Paten Heilmanns sterben lässt. Als sich jedoch der Zustand seines Vaters etwas besserte, ignorierte er fortan die Heilmann-Episode und würdigte seinen Vater, wie bereits erwähnt, im letzten Ritt. Ab Juli 1885 hatte May wieder Kraft geschöpft. Neben Ulanen und Sclaven für Münchmeyer versorgte er ebenfalls, wenn auch nur für einige Wochen, Venanz Müller vom ›Deutschen Hausschatz‹ mit weiterem Manuskript.
May beginnt, den Tod seiner Mutter zu verdrängen. Sie kann, nein sie darf nicht tot sein:
So oft ich vor diesem Grabe stehe, ist es mir, als ob mein Auge die Kraft habe, durch die Erde und durch die Wände des Sarges zu dringen, und da sehe ich ihn immer leer; … Ist das Wahnsinn? Man behauptet ja, daß ich wahnsinnig sei! Das quält mich ungemein! Das hat mich schon seit Jahren gepeinigt und peinigt mich auch noch heut. Es packt mich oft so, daß ich kaum widerstehen kann. Jetzt in diesem Augenblick, … ist es so stark und so deutlich, daß ich die Erde mit den Händen aufscharren möchte, um … zu zeigen, daß der Sarg leer ist! … Ich möchte scharren und scharren, … aber diese That wäre so außerordentlich ungeheuerlich, daß ich über den Wahnwitz erschrecke, sie mir denken zu können. Auch frage ich, wo die Mutter denn sein sollte, wenn sie nicht hier wäre? Und ich hatte und habe sie ja noch viel, viel zu lieb, als daß ich die Sünde auf mich nehmen möchte, ihr Grab geöffnet und geschändet zu haben! (587)
Diese Worte aus Mays Spätwerk Ardistan und Dchinnistan zeigen die ganze Tragweite seines Denkens und Fühlens. Im Verlornen Sohn begegnet uns eines jener merkwürdigen Mutterbilder, wie es selten sonst in der Literatur zu finden ist:
Ein fürchterlicher Gestank herrschte in dem Raume. Er war so stark, daß man trotz der Kälte ein Fenster geöffnet hatte, und kam von der weiblichen Gestalt, welche mit vollständig verhülltem Gesichte auf einem hölzernen Schemel in der Ecke hockte. (588)
»Was fehlt ihr denn?«
»Sie leidet am Krebse.«
»Am Krebse? Alle Teufel! Seit wann?«
»Seit einigen Jahren bereits.«
»Wo hat sie diese Krankheit?«
»Im Gesicht. Es ist überhaupt von einem Gesichte
bei ihr nicht mehr die Rede. Alle Fleischtheile sind
weggefressen.« (589)
Die Rede ist hier von der Frau des Theaterdieners Werner aus der Residenz. Nur schemenhaft wird sie von May skizziert. Zwar zeichnet er dem Leser ein ergreifendes Bild über ihre Familie, die mit fünf Kindern und zwei Enkeln ein Dasein in bitterster Armut fristet und keinen Arzt bezahlen kann, doch die Mutter bleibt in dem Geschehen eine unwirkliche Randperson. Wir erfahren nicht, wie sie aussieht, denn das ganze Gesicht ist weggefressen; wir erfahren auch nicht, was sie denkt und fühlt, denn sie spricht niemals ein Wort. Sie steht im Mittelpunkt, ist aber doch irgendwie nicht vorhanden. Der Leser erwartet ihren sicheren Tod, sie leidet bekanntlich an Krebs – wie Mays Mutter.
Doch dann setzt das Wunschdenken des Autors ein. Der Gesichtskrebs wird zur Gesichtsflechte und einer wundersamen Heilung steht nichts mehr im Wege:
Vor Kurzem war da weder Haut noch Fleisch zu sehen. Jetzt haben sich die Muskeln gebildet und die Gesichtshaut erscheint. In einem Monate wird Frau Werner auf die Straße gehen können, ohne sehr großes Aufsehen zu erregen. (590)
Und welch ein Wunder: Die bereits erwähnte Frau des Holzschnitzers, vom Autor bereits für tot erklärt, erwacht fast ein Jahr später von den Toten.
»Wohnt hier der Holzschnitzer Weber?«
»Jawohl.«
»Ist er zu Hause?«
»Ja. Wollen Sie zu Ihm?«
»Gewiß.«
»Ich bin seine Frau.« (591)
Immer wieder entdecken wir bei May, dass autobiographische Einflüsse ganze Romanentwürfe durcheinander bringen. Die ersten beiden Abteilungen seines großen Sozialromans waren partienweise vorzüglich gelungen, da versagte dem Autor die Kraft; er konnte seinen literarischen Vorstellungen nicht weiter gerecht werden. Zwar blieb Der verlorne Sohn spannend und unterhaltend, jedoch war es May nicht mehr möglich, sein Werk so zu verwirklichen, wie es ihm einst vorschwebte. Neunzehn Hefte eher als geplant verabschiedete sich Der Fürst des Elends. May hatte offensichtlich keine Freude mehr am Roman, nachdem er sein Konzept in der 3. Abteilung ändern musste. Vielleicht hatte aber auch sein Sozialroman nicht die große Gunst des Lesers gefunden? Die lebensnah beschriebenen Elendsszenen, hungernde und frierende Menschen, von besser gestellten Individuen radikal ausgebeutet, waren im Grunde keine ablenkende Kolportagelektüre.
Es waren Dienstboten aller Art, wie Zofen und Köchinnen, die den heißersehnten Lesestoff an der Hintertreppe vornehmer Häuser empfingen; auch Handwerker und Tagelöhner gaben ihren letzten Groschen, um dem grauen Alltag zu entfliehen. Das exotische Waldröschen wurde allen Lesebedürfnissen gerecht. Der verlorne Sohn dagegen war für viele ein Spiegel, der sich gegen sie selbst richtete. Dies wollte eigentlich niemand …
May zog sich insofern aus der Affäre, dass er märchenhafte Motive einsetzte, damit die bittere Mandel der Wahrheit eine süße Hülle erhielt. Demzufolge kann Der verlorne Sohn auch als modernes Märchen gelesen werden. Schon der Romanbeginn erinnert an die klassischen Märchenanfänge Wilhelm Grimms, ausladend und fast zu viel ausmalend:
Es war ein reizendes kleines Damenboudoir, in welchem das fröhliche Lallen eines Kindesmundes eine Damenstimme beantwortete, deren zärtlich kosende Worte von einem wunderbar weichen und herzigen Wohlklang waren. (592)
Die zweite Abteilung und die vermeintlich ursprünglich dritte Abteilung des Romans beginnt ebenso mit: ›Es war‹.
Es war am Sonnabend vor Fastnacht. (593)
Es war Mittag, die Stunde, in welcher der gewöhnliche Bürger seine Hauptmahlzeit einzunehmen pflegt. (594)
Mystisch, wie der Magier im Märchen, garniert mit einem Schuss zeitgenössischem Spiritismus, gibt sich der Fürst von Befour:
»Jetzt mag mein Ring hier leuchten. Eins,
Zwei, Drei!«
Bei dem letzten Worte entstrahlte seinem Ringe,
welchen er mit Daumen und Zeigefinger der Rechten emporhielt,
eine solche Helligkeit, daß man hätte lesen können. Er schritt
auf die Dame des Hauses zu, steckte ihr den leuchtenden Ring
an den Finger … Der Ring leuchtete fort, steckte aber
plötzlich an dem Finger einer anderen Dame und machte in ganz
kurzer Zeit die Runde in der Weise um den Tisch, daß er an der
Hand einer jeden Person einmal geleuchtet hatte. Plötzlich
brannten die Gasflammen wieder, und der Ring steckte an seinem
Finger. (595)
Der Schluss des Romans erreicht schließlich seinen märchenhaften Höhepunkt. Dort wird innerhalb kürzester Zeit ein abgebranntes Schloss samt landschaftlicher Umgebung an anderer Stelle nachgebaut, zu Ruhm und Glück der Hauptfiguren. (596)
Mit der Lieferung 101 schloss Mays dritter Münchmeyer-Roman am 31. Juli 1886. Bereits neun Monate zuvor hatte die Zeitschrift ›Deutscher Wanderer‹ ihr Erscheinen zum 7. November 1885 eingestellt, womit gleichzeitig Die Liebe des Ulanen endete. Im Anschluss gab Münchmeyer sein Sammelwerk ›Alpenrosen‹ heraus, das keinen May-Beitrag enthielt. Noch im selben Jahr begann erneut ein Lieferungsroman vom Verfasser des »Waldröschen« und »der Fürst des Elends«.
Mays vierter Münchmeyer-Roman Deutsche Herzen, deutsche Helden startete Weihnachten 1885. Die Geschicke der Familie Adlerhorst erregten fortan einmal wöchentlich die Anteilnahme des Lesers. In den Lieferungen 33, 34 und 35 fehlten hintereinander die Bilderbeilagen, und wieder war es ein Todesfall, der Mays Pläne völlig durcheinander brachte.
Nach dem 13. Juni 1886 gab es in sämtlichen Zeitungen des Deutschen Reiches nur die eine Meldung:
König Ludwig II. von Bayern im Starnberger See bei Schloß Berg ertrunken!
Etwa zwei Wochen zuvor hatte May die Kurzerzählung Unter der Windhose für den Verlag K. Thienemann in Stuttgart verfasst. (597) Anschließend begann er mit den Vorarbeiten zu seinem fünften Münchmeyer-Roman Delila, denn das Schlusskapitel Ende gut, Alles gut! befand sich für den Verlornen Sohn seit Ende Mai im Druck.
Delila versprach ein hochinteressantes Werk um Liebe und Verrat, mit jeder Menge Emilias zu werden. Bereits 1881 fand sich Delila im ›Deutschen Hausschatz‹ erwähnt:
»Ihr Haar ist wie der Schweif des Pferdes Gilja, und ihr Fuß ist wie der Fuß von Delila, welche Samson verrieth. …« (598)
May zeigte somit schon frühzeitig seine Faszination für diese biblische Erscheinung. Siebzig bis achtzig Seiten Delila-Manuskript (599) entstanden Mitte Juni 1886. Kurz vor der Drucklegung geschah dann das mysteriöse Unglück im Starnberger See; hier waren sämtliche Kolportageverleger gefordert, und Münchmeyer ließ sich diese einmalige Chance nicht entgehen.
Niemand vermochte besser den märchenhaften Lebensweg König Ludwigs in mystische Worte zu kleiden und in über hundert Lieferungen dem Leser fesselnder darzustellen als sein Starautor Karl May. Dafür legte Münchmeyer gern die heißblütige Delila auf Eis. Die Annahme, das Delila-Fragment sei als sechster Münchmeyer-Roman nach dem Weg zum Glück entstanden, ist, wie sich noch zeigen wird, unhaltbar.
Karl May, der ohnehin am tagespolitischen Geschehen reges Interesse fand, musste bestimmt nicht lange von Münchmeyer überredet werden, dem Weg zum Glück gegenüber Delila, den Vorrang zu geben, so starteten die Höchst interessanten Begebenheiten aus dem Leben und Wirken des König Ludwig II. von Baiern mit der letzten Lieferung des Verlornen Sohn am 31. Juli 1886.
Durch Delila hatte May wertvolle Zeit verloren, er musste deshalb die Deutschen Herzen und Helden vernachlässigen. Dies ist auch der Grund, weshalb bald darauf dreimal hintereinander die Bilderbeilagen fehlten. Das Thema ›König Ludwig‹ besaß jetzt einfach Priorität, die unmittelbare Konkurrenz schlief nicht. Der Dresdner Verlag Dietrich gab im Wettrennen gegen den Weg zum Glück ebenfalls einen umfangreichen, historischen Roman über König Ludwig heraus: ›Der Einsiedler am Starnberger See‹. (600) Dies erforderte höhere Qualität, vor allen Dingen aber regelmäßiges Erscheinen. Kontinuierlich fließen aus Mays Feder zwei Lieferungen pro Woche, zum einen Deutsche Helden, zum anderen Weg zum Glück.
Damit nicht genug, lässt er sich nun auch noch mit dem bekannten Publizisten Joseph Kürschner, dem Herausgeber des Literaturkalenders, in Verhandlungen wegen einiger neuer Unternehmungen ein, für die er die Einsendung von Manuskripten verspricht. Wie er später bekennt, arbeitete er mit allen Eifer auf die Trennung von Münchmeyer hin … (601)
In diesem Zusammenhang schreibt May am 11. September 1886 Kürschner einen aufschlussreichen Brief:
Ferner habe ich auch für Sie bereits eine Arbeit unter der Feder … »Die Schejtana«, also »Die Teufelin«, … also eine jener Araberinnen als Hauptheldin …, welche in Folge von Geburt, Schönheit, Reichthum und geistiger Begabung einen größeren Einfluß erlangen als der eigentliche, männliche, Beherrscher des Stammes. Eine solche Kahremana (Heldin) bietet sowohl in seelischer als auch in Beziehung auf ihre äußeren Schicksale für einen guten Roman ein Sujet, wie es interessanter und wirkungsvoller wohl schwerlich gedacht werden kann … Es wird ca. 100 Druckseiten von ›Vom Fels zum Meer‹ füllen, falls Sie einverstanden sind. … (602)
Ob Kürschner einverstanden war oder nicht, ist hier nebensächlich. Die ›Schejtana‹ verdient unsere volle Aufmerksamkeit. Eine solche arabische Hauptheldin hätte praktisch ebenso Delila heißen können. Schließlich verfügte May seit Juni 1886 über den Anfang eines packenden Frauenromans, den er zweifellos in klingende Münze umzusetzen gedachte. Was lag näher, als aus dem vorhandenen Material eine Novelle zu formen. Doch leider durfte Delila auch als ›Schejtana‹ keine Männer betören. So ließ sich May wohl das Geld für den abgebrochen Roman von Münchmeyer auszahlen, mit der Option, ihn nach dem Weg zum Glück fortzusetzen. Delila landete also im Verlagsarchiv, wo sie allmählich einstaubte und später zu einem unangenehmen Beweismittel gegen May werden sollte.
Immerhin war Joseph Kürschner derjenige, der zwischen Karl May und dem Verleger Wilhelm Spemann eine Verbindung herstellte, wie sie fruchtbarer kaum sein konnte. Es stand die Gründung einer neuartigen ›Illustrierten Knaben-Zeitung‹ bevor – ›Der Gute Kamerad‹. Und hier schlug am 8. Januar 1887 Mays große Stunde als Jugendschriftsteller. Mitte November 1886 dürfte er mit dem Sohn des Bärenjägers begonnen haben. Glücklicherweise blieben einige Briefe Spemanns erhalten, wonach die genaue Textentstehung rekonstruiert werden kann. Indirekt erhält man somit auch wichtige Informationen über die Münchmeyer-Romane:
11. Januar 1887
»… Die Liebenswürdigkeit, mit der Sie meinem Wunsche
nachgekommen sind, und mir die ersten Fortsetzungen sandten,
läßt mich die Bitte aussprechen, doch recht bald weiteres
Manuskript zu schicken. Sie wissen vielleicht nicht so, wie ich,
wie schwer es hält, von den Künstlern rechtzeitig die
Illustrationen zu erhalten, …«
25. Februar 1887
»… Mit verbindlichen Dank empfing ich weitere 100 Seiten des
›Bärenjägers‹ …«
27. Juli 1887
»… Wir kommen heute mit der dringenden Bitte zu Ihnen, uns
weiteres Manuskript … einzusenden. … Mit dem uns noch
vorliegenden Manuskript reichen wir bis No. 35 … augenblicklich
ist No. 32 in der Presse … Um Ihnen zur Bemessung des Umfangs
des noch Fehlenden zu geben, bemerken wir, daß noch 90–100
Seiten Ihres Manuskripts … erforderlich sind. …«
5. September 1887
»… Wir haben erst heute das noch vorhandene Manuskript … genau
abschätzen können und gefunden, daß uns noch 8 Blatt Manuskript
fehlen, welche den Schluß des Ganzen bilden sollen …« (603)
Ich rekapituliere: Am 8. Januar 1887 startete ›Der Gute Kamerad‹ mit dem Sohn des Bärenjägers. Hierfür entstand Manuskript vermutlich ab Mitte November 1886, danach schubweise bis Mitte Februar, und nach einer längeren Pause ›90–100 Seiten‹ Anfang August sowie das restliche Schlussteilstück im September 1887. Durch das vorzeitige Beenden des Jahrgangs mit der Nummer 39 erreichte auch ›Der Gute Kamerad‹ den damals obligaten Turnus von Oktober zu Oktober.
Wie sich denken lässt, war Münchmeyer über diese Entwicklung keineswegs erfreut. Immer kürzer wurden jetzt die Abstände zwischen Niederschrift und Druckbeginn. Textillustrationen pünktlich anzufertigen, war jetzt fast eine Unmöglichkeit. Um jedoch halbwegs regelmäßig die einzelnen Hefte mit einer Bilderbeilage auszustatten, musste ein Kompromiss gefunden werden. So konnten sich zwar die Leser an bunten Bildern erfreuen, jedoch nur als überfällige Rückschau von längst vergangenen Episoden, Grund genug für Münchmeyer einzugreifen, in dem er seinen Kettenhund auf May hetzte:
… und so erschien denn das Faktotum Walter eines schönen Tages bei mir, um mir mit gleissender Freundlichkeit ein Schriftstück vorzulegen, welches ich unterschreiben sollte. … Es ist ein Meisterstück der Kolportagepfiffigkeit, der Walterschen Geriebenheit; denn dass dieser es verfasst hat, darüber gibt es bei mir keinen Zweifel. … Nun sollte ich mich jetzt plötzlich kontraktlich verpflichten, wöchentlich fünf Nummern zu liefern und hierbei nur so nebenhin mit unterschreiben, dass ich an Herrn Münchmeyer das alleinige, freie, unbeschränkte Verlags-, Eigentums- sowie Uebersetzungsrecht abtrete. Es ist zu betonen, dass das Urheberrecht nicht mit erwähnt worden ist. Ferner ist es selbst dem fleissigsten Verfasser unmöglich, sich auf regelmässig wöchentlich fünf Nummern zu verpflichten. Das wäre sein Tod! Ich habe für Münchmeyer über 500 Nummern geschrieben; das ergibt wöchentlich über zwei. Es ist aber die Regel, an die Abonnenten wöchentlich nur eine Nummer zu liefern. Also habe ich grad doppelt so viel geschrieben, als eigentlich nötig war. (604)
Karl May verweist hier auf einen vom 3. März 1887 datierten ›Revers‹. (605) Das Faktotum Walther erschien also zu einem Zeitpunkt, als der Druck des Bärenjägers in vollem Gange war. Fünf anstelle von zwei Lieferungen sollte May von jetzt an für den Kolporteur schreiben! Durch diese dreiste Mehrforderung verging ihm endgültig die Lust, an der Kolportage festzuhalten.
Venanz Müller vom ›Deutschen Hausschatz‹ hingegen war in der Tat berechtigt, seine Unzufriedenheit über Mays Mitarbeit öffentlich kundzutun:
»Auf mehrere Anfragen. Es ist uns höchst peinlich, daß abermals – und ganz gegen unsere Erwartung – eine Unterbrechung in der Reise-Erzählung ›Der letzte Ritt‹ eingetreten ist. Leider haben wir bis jetzt das fehlende Manuscript noch nicht erhalten und entbehren zur Zeit jede Nachricht von dem Verfasser. In Zukunft werden wir freilich niemals mehr mit der Veröffentlichung irgend eines Werkes beginnen, ohne daß uns das Manuscript vollständig vorliegt.« (606)
Diese Redaktionsnotiz erreichte die Hausschatz-Leser bereits Ende Mai 1886, als König Ludwig noch nicht daran dachte, im Starnberger See zu sterben. Ein gutes Jahr später, im Spätsommer 1887, bot May endlich nach seinen jüngsten Erfahrungen dem unbequemen Münchmeyer die Stirn. Er beabsichtigte keineswegs mehr, neben seiner Tätigkeit für Spemann die Arbeiten an Delila irgendwann einmal fortzusetzen. Der Abschied von der Kolportage wurde eingeläutet:
|
»An unsere Leser! |
| Mit dem nächsten Heft beginnt der XIV. Jahrgang des ›Deutschen Hausschatzes‹. Im Besonderen erwähnen wir, daß für den XIV. Jahrgang unserer Zeitschrift bereits ein großer Manuscripttheil einer neuen Reise-Erzählung von Karl May vorliegt, betitelt: |
|
›Durch das Land der Skipetaren‹. |
| Abgesehen von dem spamnenden Gang ihrer Handlung, ist diese hochromantische Erzählung auch in ethnographischer Hinsicht von besonderem Interesse, namentlich in jetziger Zeit, wo die Augen Europa’s auf die Balkanländer gerichtet sind.« (607) |
Noch im Juni 1887 lag der Hausschatz-Redaktion keine Fortsetzung für den Letzten Ritt vor. (608) Dieser Zustand änderte sich dann bis Mitte September, wie der eben zitierte Abonnentenaufruf genügend dokumentiert. May nahm also wieder einmal regen Anteil am aktuellen Zeitgeschehen:
Ein angenehmes Gefühl ist es jedoch nicht, zwischen zwei bärenstarken und bis an die Zähne bewaffneten Wegelagerern zu sitzen. Daß es in der Türkei eine Menge solcher Menschen geben kann, das ist sehr leicht erklärlich; es liegt an den dortigen Verhältnissen. Liest man doch sogar heut zu Tage in fast jeder Nummer irgend einer Zeitung von gewaltsamen Grenzüberschreitungen, Räubereien und Ausplünderungen. Erst im vorletzten Monat des Jahres 1887 hat die Regierung eine Bekanntmachung erlassen, in welcher sie befiehlt, daß jeder Richter nun endlich doch einmal nach dem Gesetz urtheilen solle. (609)
Claus Roxin verwies bereits vor längerer Zeit in seiner Einführung zum Skipetaren-Reprint auf diese wichtige Textstelle. (610) Demnach befand sich May schon ganz in dem Metier seiner Reiseerzählungen. Kolportage-Manuskripte entstanden nun mit flüchtiger Hand nebenher. Mitte Januar 1888 endete der Roman Deutsche Herzen, deutsche Helden. Im Anschluss erhielt Spemann umgehend den Anfang der händeringend erwarteten Nachfolgeerzählung zum Sohn des Bärenjägers:
»Soeben erhalte ich Ihre Sendung Der Geist des Llano estakado und werde mich sofort an die Lektüre machen. …, 25. Januar 1888.« (611)
Bereits zwei Wochen später (!) begann Mays brandneue Jugenderzählung im ›Guten Kameraden‹, fraglos ein deutlicher Beweis für die ungeheure Nachfrage, die seinen Texten entgegengebracht wurden. Schrieb er 1887 an drei Romanen gleichzeitig: Helden, Glück und Bärenjäger (später anstelle Bärenjäger die Skipetaren), so sollte es 1888 nicht anders sein. Parallel entstanden in der ersten Jahreshälfte: Glück, Skipetaren und Llano estakado (ab Mitte April anstelle Skipetaren weitere Arbeiten für den Hausschatz).
Ich habe in jener Zeit des elendesten Innenlebens unendlich fleißig gearbeitet und meinen Lesern nur Glauben und Gottvertrauen, Liebe, Glück und Sonnenschein gegeben. Es giebt einzelne Jahre, in denen ich 6–8 neue Bände schrieb. Das hat vorher noch Niemand fertig gebracht, und auch nachher wird wohl Keiner kommen! Es gab Wochen, in denen ich drei und auch vier Nächte durcharbeitete. (612)
Immer sporadischer widmete er sich dabei dem Weg zum Glück. Die bunten Bilderbeilagen hinkten den passenden Romantexten um bis zu sieben Wochen hinterher. Was May also schrieb, gelangte unmittelbar danach zum Setzer.
Eine wichtige Datierungshilfe befindet sich in Lieferung 88. Dort empfängt der Krikelanton einen Brief:
Elsbethen, den 20. März … (613)
Der Inhalt des Briefes ist nicht relevant, ausschließlich das Datum interessiert hier. Exakt zu diesem Zeitpunkt entstand jene Manuskriptpassage. Zwei Seiten später war die Lieferung komplett und konnte somit sofort in Druck gehen; am 31. März 1888 erreichte sie den Leser. Die Probe hält jedem Zweifel stand. Zählt man nämlich genau achtundachtzig Wochenlieferungen zurück, so setzt die erste Lieferung folgerichtig mit dem 31. Juli 1886 ein, und wie bereits erwähnt, endete zu diesem Zeitpunkt Der verlorne Sohn, wobei Der Weg zum Glück gleichzeitig startete, – dies kann kein Zufall sein. Überhaupt gehen die sorgsamen Zeitberechnungen bei allen fünf Münchmeyer-Romanen auf. Sämtliche Daten korrespondieren logisch miteinander. Was vorher als unmöglich galt, ist gelungen: die Laufzeiten sind exakt ermittelt.
Aus vielen Anhaltspunkten und dem genannten
Datenmaterial konnte eine anschauliche Tabelle erstellt werden,
die für weiterführenden Forschungen geeignet ist. (614) Oftmals braucht man nur zwei bis
drei Wochen zurückrechnen, um auf die tatsächlichen
Entstehungszeiten zu kommen. Ein Beweis dafür, dass Mays
Manuskripte nicht selten buchstäblich im letzten Augenblick den
Setzer erreichten, liefert die folgende Textstelle:
Der Setzer Münchmeyers dachte tatsächlich, hier
wäre der Roman zu Ende und setzte das Schlusszeichen. Ganz
offensichtlich fehlte weiteres Manuskript. Als May schließlich
doch noch eine Lieferung in die Druckerei schickte, war es
bereits zu spät; es kam, wie der Autor sagen würde, zum
Doppelschluss:
Jetzt erst war in der Tat das Schlusszeichen berechtigt, aber trägt an diesem Doppelschluss einzig und allein der Setzer die Schuld? Warum provoziert May auf Seite 2576 dieses Missverständnis und lässt seinen Text mit den Worten Weg zum Glück ausklingen?
König Ludwig starb bekanntlich am Pfingstsonntag, den 13. Juni 1886. Zu Beginn des Schlusskapitels in Lieferung 104 heißt es deshalb vielsagend:
Der Frühling war eingezogen, und das schöne, heilige Pfingstfest stand vor der Thür. (617)
Man sollte meinen, dass der Autor nun den Tod des geliebten Monarchen schildern würde. Weit gefehlt. Kurzfristig überlegte May es sich anders und ließ den Roman vorerst positiv enden. Warum? Gab es etwas, was ihn jäh davon abhielt vom Tod zu schreiben? Diese Frage findet rasch ihre traurige Bestätigung.
Das Befinden von Mays Vater, der nach seinem Schlaganfall zum Pflegefall wurde, verschlechterte sich zusehends. Karl May dürfte ständig über den Zustand des Kranken unterrichtet gewesen sein. Er gab nicht unbedeutende Summen für eine angemessene ärztliche Versorgung aus. Dasselbe dürfte übrigens auch bei seiner Mutter der Fall gewesen sein, nachdem sie wohl schon 1884 an Krebs erkrankt war. Hier offenbaren sich die Gründe, warum May solange die finanzielle Sicherheit bei Münchmeyer suchte und einen Roman nach dem andern schrieb. (618)
Am 6. September 1888 stirbt Heinrich August May. Unter diesem Einfluss, vielleicht auch unter Münchmeyers Drängen, der das Ende Ludwigs im Roman dokumentiert haben wollte, nimmt May seine Arbeit am Weg zum Glück noch einmal auf. Hier wird der kauzige Wurzelsepp zur Vatergestalt und stirbt zeitgleich mit König Ludwig.
Das Verzeichnis der Bilderbeilagen ist in diesem
Zusammenhang aufschlussreich:
Die Illustration der Lieferung 108 »Sonntagabend auf der Alm« wird nicht genannt, da der Roman zunächst vorzeitig endete. Ohnehin stellt sie eine Verlegenheitslösung dar. Sie zeigt eine Begebenheit aus den Anfängen des Romans, und war zunächst die erste Bildbeilage überhaupt, bis später ein Szenenbild mit König Ludwig Verwendung fand. Dies lässt sich u.a. einer Fußnote entnehmen. In Scheibenbad steht die Leni mit ihrem Wurzelsepp gemeinsam auf der Bühne:
Ein Theaterdiener brachte den alten Hut, den Bergstock und
die Zither herbei. Die Letztere nahm der Alte auf die Kniee,
den Stock aber, auf den er den Hut stülpte, lehnte er unter
den Käfig an die Wand. Als nun die Leni an den einen
Thürpfosten trat, bildeten sie ganz genau
dieselbe Gruppe wie im vorigen September droben auf der Alm,
wo sie auch mit einander sangen, ehe der König bei Leni
erschien.*)
*) Siehe das Bild zum ersten Hefte dieses Romanes. (620)
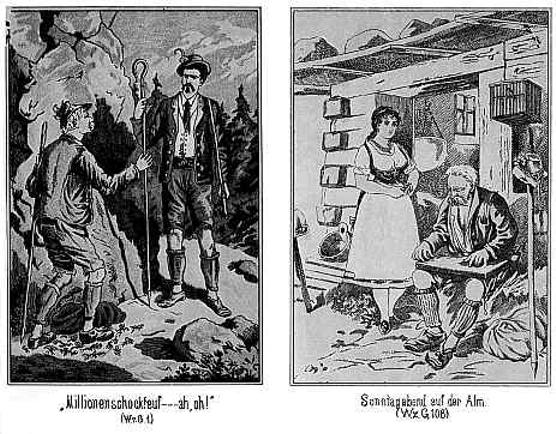
Noch während des Erstdruckes wurden die Bilder ausgetauscht.
Nach Lieferung 107 blieb folglich jene ursprünglich erste
Illustration übrig, die dann schließlich als letzte
Bilderbeilage verwendet wurde.
Im Herbst 2004 konnte das Karl-May-Museum in
Radebeul durch einen glücklichen Umstand eine komplette
Erstausgabe des Romans Der Weg zum Glück in 109
Einzellieferungen erwerben. Lediglich die Hefte 1, 108 und 109
sind ohne Umschlag. Anhand dieser Ausgabe bewahrheitet sich,
dass der Roman ursprünglich auf Seite 2576 endete. Von den
Seiten 2577ff. gibt es zwei unterschiedliche Versionen:
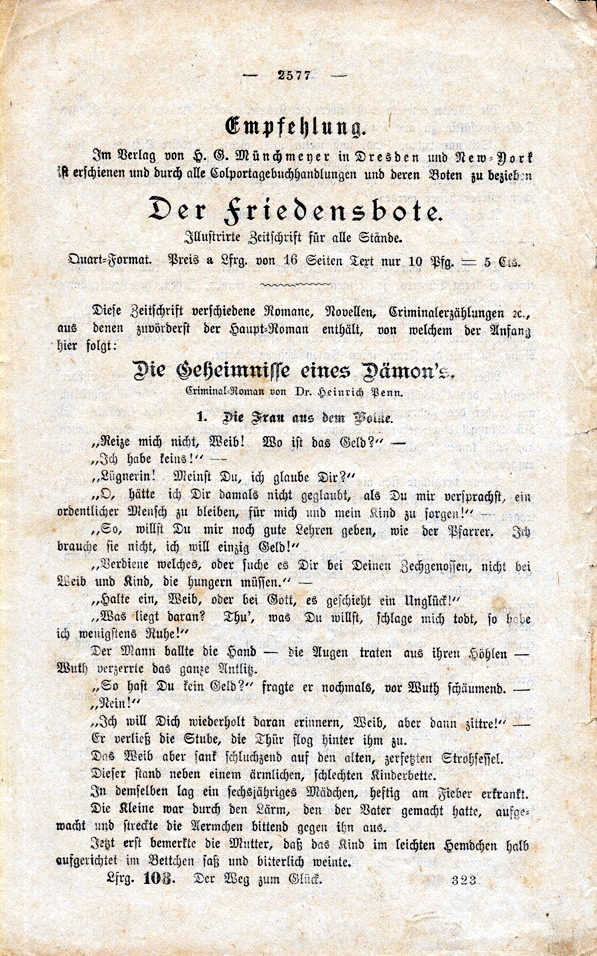
Zunächst erschien, um das Heft 108 zu füllen, eine Empfehlung für die Zeitschrift ›Der Friedensbote‹ mit dem Beginn des Romans ›Die Geheimnisse eines Dämon’s‹, ferner ein Fremdbild zur Erzählung ›Die Amazonen von Calabrien‹ – mit Karl May hatte das selbstverständlich gar nichts zu tun. Als er schließlich seinen zweiten Schluss geschrieben hatte, wurden die Seiten 2577ff. völlig neu gesetzt.
Mit der Lieferung 108 vom 22. September 1888 beendet May seine Kolportagetätigkeit endgültig. Delilah war kein Thema mehr. Eine gewaltige Arbeitsleistung lag hinter May: fünfzig Manuskriptseiten wöchentlich Weg zum Glück, dazu ebenso fünfzig Seiten Skipetaren sowie in den Monaten Januar bis September 1888 insgesamt dreihundertfünfzig Seiten Geist des Llano estakado. Nachdem er Mitte April 1888 die Skipetaren abgeschlossen hatte, (621) begann er ohne schöpferische Pause mit dem Scout:
»…, den Freunden des Abenteuerromans aber verrathen wir, daß sich in unseren Händen wieder eine sehr nende Erzählung von Carl May aus der Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkriege befindet, die ebenfalls im neuen Jahrgang zum Abdruck gelangen wird.«
Diese Redaktionsnotiz erreichte Anfang Oktober 1888 die Hausschatz-Leser. (622) Mit großer Sicherheit entstand Der Scout bereits zwischen Mai und Anfang Juli. Das bei Münchmeyer spät eintreffende Manuskript – Der Weg zum Glück endete zunächst, wie sich aus der wöchentlichen Erscheinungsweise errechnen lässt, am 11. August – und die wiederholten Hilferufe Spemanns – am 5. Juli reichte der Geist nicht einmal für die nächste im Satze stehende Nummer (!), wobei der Schlussteil am 30. August noch immer nicht ganz vorlag – machen einmal mehr Mays dauerhafte Überlastung, zum anderen seine rege Tätigkeit für den ›Deutschen Hausschatz‹ deutlich.
Nach dem Scout begann er Mitte Juli umgehend mit El Sendador. Eine zeitige Beschäftigung mit der Jugenderzählung Kong-Kheou, das Ehrenwort etwa Anfang August muss hier ebenso berücksichtigt werden, weil dieser Text, der Ende September startete, ausnahmslos die passenden Illustrationen enthielt. (623)
Warum Karl May all diese Strapazen auf sich nahm, liegt auf der Hand. Sein Vater, Heinrich August May, war nach seinem Schlaganfall dauerhaft pflegebedürftig. Sein einziger Sohn unterstützte ihn drei Jahre lang bis zu dessem Tode »mit monatlich 40 Mark – immerhin knapp 10 Prozent seiner gesamten Einkünfte« (623a), wie Hans Wollschläger anmerkt. Darüber hinaus wollte May sich wohl auch einen Grundstock schaffen, mietete er doch ab dem 1. Oktober 1888 die teure Villa Idylle. (624)
Ich machte Schluß und zog von Dresden fort, nach Kötzschenbroda, dem äußersten Punkt seiner Vorortsperipherie. (625)
Münchmeyer bleibt fortan sich selbst überlassen. Kaum vier Jahre später stirbt er einsam in der Schweiz, fast sterbend von fremden Leuten hingeschafft und von fremden Leuten behandelt. (626)
Anmerkungen
(556) Laut Totenbuch starb Christiane Wilhelmine May am 15. April 1885 an einer »Geschwulst«.
(557) Karl May: ›Der verlorne Sohn‹, wie Anm. 26, Lfg. 33, S. 787.
(558) Karl May: ›Mein Leben und Streben‹, wie Anm. 80, S. 155.
(559) In: ›Anzeiger für Ernstthal, Hohenstein, Oberlungwitz, Gersdorf und Umgebung‹, Nr. 44, 16. April 1885.
(560) Aus einem 4 Seiten Manuskript Klara Mays von 1932 (Original im KM-Archiv Bamberg); zitiert nach Hans Wollschläger: ›Die sogenannte Spaltung des menschlichen Innern, ein Bild der Menschheitsspaltung überhaupt‹. Materialien zu einer Charakteranalyse Mays. In: Jb-KMG 1972/73, Hamburg 1973, S. 50 u. 89.
(561) Aus einem 4 Seiten Manuskript Klara Mays von 1932, wie Anm. 560, S. 50.
(562) Karl May: ›Der letzte Ritt‹, wie Anm. 41, 12. Jg. 1885/86, Nr. 7, S. 108.
(563) Ebd., Nr. 3, S. 40.
(564) Karl May: ›Der verlorne Sohn‹, wie Anm. 26, Lfg. 43, S. 1027.
(565) Ebd., Lfg. 49, S. 1165 u. 1166.
(566) Walther Ilmer: ›Die Übel des Ulanen‹. In: M-KMG 102, 1994, S. 26.
(567) Das Bertha-Brand-Fragment: ›Ulane und Zouave‹. In: ›Die Liebe des Ulanen‹, Lfg. 88, S. 1400 u. 1401.
(568) Claus Roxin: ›»Die Liebe des Ulanen« im Urtext II‹. In: M-KMG 15, 1973, S. 6–11.
(569) Karl May: ›Der verlorne Sohn‹, wie Anm. 26, Lfg. 40, S. 960.
(570) Karl May: ›Ulane und Zouave‹, wie Anm. 567, Lfg. 88, S. 1393.
(571) Deutscher Wanderer, wie Anm. 17, Lfg. 87, S. 1377.
(572) Zitiert nach Wollschläger und Wiedenroth: ›Editorischer Bericht‹. In: ›Die Liebe des Ulanen‹, HKA, Bd. 13, Bargfeld 1994, S. 2530.
(573) Deutscher Wanderer, wie Anm. 17, Lfg. 102, S. 1617.
(574) Karl May: ›Der Sohn des Bärenjägers‹, wie Anm. 45, Nr. 26, S. 395.
(575) Vgl. Kapitel ›Wortspiele‹.
(576) Karl May: ›Ulane und Zouave‹, wie Anm. 567, Lfg. 89, S. 1413.
(577) Ebd., Lfg. 88, S. 1398.
(578) Karl May: ›Der verlorne Sohn‹, wie Anm. 26, Lfg. 42, S. 993f.
(579) Karl May: ›Wanda‹, wie Anm. 102, S. 687
(580) Karl May: ›Der Weg zum Glück‹, wie Anm. 16, Lfg. 8, S. 173.
(581) Karl May: ›Auf der See gefangen‹, wie Anm. 40, S. 498.
(582) Karl May: ›Ulane und Zouave‹, wie Anm. 567, Lfg. 89, S. 1411.
(583) Claus Roxin: ›»Die Liebe des Ulanen« im Urtext‹, wie Anm. 568, S. 9.
(584) Karl May: ›Die Liebe des Ulanen‹, wie Anm. 17, Lfg. 91, S. 1446.
(585) Karl May: ›Der verlorne Sohn‹, wie Anm. 26, Lfg. 41, S. 963.
(586) Emmas Großvater, ›der alte Pollmer‹, starb am 26. Mai 1880 in Hohenstein.
(587) Karl May: ›Ardistan und Dschinnistan‹, Erster Band, Manuskriptfassung, herausgegeben von Hans Wollschläger unter Mitarbeit von Franziska Schmitt, Bamberg · Radebeul 2005, S. 302.
(588) Karl May: ›Der verlorne Sohn‹, wie Anm. 26, Lfg. 54, S. 1277.
(589) Ebd., Lfg. 55, S. 1310.
(590) Ebd., Lfg. 87, S. 2076.
(591) Ebd., Lfg. 82, S. 1960.
(592) Ebd., Lfg. 1, S. 1.
(593) Ebd., Lfg. 21, S. 481.
(594) Karl May: ›Ulane und Zouave‹, wie Anm. 567, Lfg. 88, S. 1393.
(595) Karl May: ›Der verlorne Sohn‹, wie Anm. 26, Lfg. 6, S. 131.
(596) Ebd., Lfg. 101, S. 2409. Vgl. Andreas Graf: ›Ja, das Schreiben und das Lesen…‹. In: Jb-KMG 1994, Husum 1994, S. 209.
(597) Laut Verlagsbestätigung vom 8. Juni 1886. Vgl. Siegfried Augustin: Einführung zu ›Unter der Windhose‹, in: ›Der Krumir‹, Reprint der KMG 1985, S. 154.
(598) Karl May: ›Die Tschikarma‹, wie Anm. 159, Nr. 22, S. 346.
(599) Das ca. 70–80 Seiten umfassende Manuskript ›Delila‹ wurde später von Karl May oder von seiner zweiten Frau Klara vernichtet, nach Ermittlungen von Ludwig Patsch. Vgl. Hans Wollschläger: ›Karl May. Grundriß eines gebrochenen Lebens‹, wie Anm. 10, S. 192.
(600) Robert Frankenburg: ›Der Einsiedler am Starnberger See‹, Historischer Roman, Verlag Rich. Herm. Dietrich, Dresden 1886.
(601) Karl May: ›Pollmer-Studie‹, wie Anm. 176, Manuskriptseite 846.
(602) May an Kürschner, Dresden A., Prinzenstraße 4, d. 11.9.1886; zitiert nach Andreas Graf: ›»Von einer monatelangen Reise zurückkehrend«. Neue Fragmente aus dem Briefwechsel Karl Mays mit Joseph Kürschner und Wilhelm Spemann (1882–1897).‹ In: Jb-KMG 1992, Husum 1992, S. 132f.
(603) Die zitierten Briefe Spemanns an May sind ungekürzt im KMG-Reprint ›Der Sohn des Bärenjägers‹, S. 263f. abgedruckt.
(604) Karl May: ›Ein Schundverlag‹, wie Anm. 6, S. 354f.
(605) Nach Ermittlungen von Klaus Hoffmann. Vgl. Hainer Plaul: Anhang zu ›Mein Leben und Streben‹, wie Anm. 392, S. 431.
(606) Deutscher Hausschatz, wie Anm. 1, 12. Jg., Nr. 36, Mai 1886.
(607) Deutscher Hausschatz, wie Anm. 1, 13. Jg., Heft 18, September 1887.
(608) Deutscher Hausschatz, wie Anm. 1, 13. Jg., Heft 12, Juni 1887.
(609) Karl May: ›Durch das Land der Skipetaren, wie Anm. 75, Heft 8, S. 324.
(610) Claus Roxin: Einführung zu ›Durch das Land der Skipetaren‹, Reprint der KMG 1978, S. 2.
(611) Vgl. Anmerkung 603.
(612) Karl May: ›Pollmer-Studie‹, wie Anm. 176, Manuskriptseite 849.
(613) Karl May: ›Der Weg zum Glück‹, wie Anm. 16, Lfg. 88, S. 2110.
(615) Karl May: ›Der Weg zum Glück‹, wie Anm. 16, Lfg. 108, S. 2576.
(616) Ebd., Lfg. 109, S. 2616.
(617) Ebd., Lfg. 104, S. 2490.
(618) Vgl. Hans Wollschläger und Hermann Wiedenroth: ›Editorischer Bericht‹. In: ›Deutsche Herzen, deutsche Helden‹, HKA, Bd. 25, Bargfeld 1997, S. 3531.
(619) Das ›Verzeichnis der Bilderbeilagen‹ wurde neben einem Titelblatt stets mit der letzten Lieferung eines Romans ausgegeben. Die Bezieher konnten dann alle Lieferungen einbinden lassen.
(620) Karl May: ›Der Weg zum Glück‹, wie Anm. 16, Lfg. 20, S. 460.
(621) May kündigte Mitte April 1888 dem Verleger Friedrich Pustet die beiden Erzählungen ›Der Scout‹ und ›El Sendador‹ an. Der Brief blieb leider nicht erhalten, wohl aber Pustets Antwort vom 23. April 1888. Vgl. Wollschläger und Wiedenroth, Editorischer Bericht. In: ›In den Cordilleren‹, HKA, Bd. 8, Nördlingen 1988, S. 493.
(622) Redaktionsschluss dieser Nummer war der 10. September 1888.
(623) Wie aus dem Briefwechsel Spemann/May ersichtlich, sind die ersten Seiten zum ›Kong-Kheou‹ (Im Pfeffergäßchen) möglicherweise bereits kurz nach dem 5. September 1887 in einem Arbeitsgang mit dem Schlussteil vom ›Bärenjäger‹ entstanden.
(623a) Vgl. Hans Wollschläger und Hermann Wiedenroth: ›Editorischer Bericht‹, wie Anm. 618, S. 3531.
(624) Die Jahresmiete betrug eine für die damalige Zeit stolze Summe: 800 Mark jährlich, davon waren jeweils 200 Mark vierteljährlich im voraus zu bezahlen, STA Dresden, Akte AG Dresden, Nr. 2971, Cg VII 59/90, Bl. 2.
(625) Karl May: ›Mein Leben und Streben‹, wie Anm. 80, S. 207.
(626) Karl May: ›Ein Schundverlag‹, wie Anm. 6, S. 358. Heinrich Gotthold Münchmeyer verstarb am 6. April 1892, 17.00 Uhr, in Davos-Platz, wo er seine fortgeschrittene Lungenschwindsucht auszuheilen suchte; laut Hainer Plaul: Anhang zu ›Mein Leben und Streben‹, wie Anm. 392, S. 434, Anm. 246.