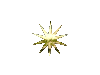
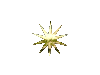
Nach aktuellen Forschungsergebnissen müssen wir davon ausgehen, dass der neunzehnjährige Karl May tatsächlich – der Darstellung in der Selbstbiographie Mein Leben und Streben (1910) entsprechend – am 24. Dezember 1861 auf dem Christmarkt in Hohenstein von der Polizei festgenommen wurde. Nach einem Verhör im Rathaus, bei dem er sich besonders ungeschickt verhielt, musste Karl May den Heiligen Abend »hinter Schloß und Riegel« verbringen: als höchstens geringfügig schuldiger und – zu Unrecht – des Diebstahls einer Taschenuhr bezichtigter Untersuchungshäftling in Chemnitz.
Wie mag es dem sensiblen, verstörten, von einem jähen Schicksalsschlag getroffenen jungen Mann, der den Heiligen Abend zum ersten Mal außerhalb des Elternhauses – und noch dazu im Gefängnis – erleben und erleiden musste, innerlich ergangen sein? Jeder einfühlsame Mensch wird sich Mays Befindlichkeit in der Gefängniszelle vorstellen können. Karl Mays bekanntes, sechzehn Strophen umfassendes Gedicht Weihnachtsabend (als dessen Entstehungszeit meist der Advent 1867 angenommen wird) könnte uns zusätzlich Aufschluss geben.
Einzelne Strophen dieses hoch emotionalen – und zumindest teilweise autobiographischen – Weihnachtsgedichts hat Karl May ins spätere Erzählwerk integriert: in die Dorfgeschichte Der Giftheiner, in die Kolportageromane Waldröschen und Der verlorne Sohn, in das (vom Redakteur des ›Deutschen Hausschatzes‹ gestrichene) Krüger Bei-Kapitel ›In der Heimath‹ und in die späte Reiseerzählung »Weihnacht!«. Das Weihnachtsgeheimnis (die Geburt des Erlösers) und die österlichen Mysterien (Tod und Auferstehung) werden im Gedicht – wie auch sonst sehr oft in Mays Erzählungen – auf eigenartige Weise zusammengeschaut: im Gedicht, wie im Verlornen Sohn und in anderen Romanen, stirbt der Gefangene und findet endgültige Gnade bei Gott.
Ob May selbst sich Ende 1861 und/oder in den folgenden Jahren den Tod gewünscht hat, wissen wir allerdings nicht. Vielleicht fühlte sich der Gefangene wie ›tot‹ und sehnte sich, als gläubiger Christ, umso inniger nach der Nähe des Erlösers, des »Heilands«. Jedenfalls hat Karl May seine Weihnachtshoffnung und zugleich sein Weihnachtstrauma in vielfachen Variationen literarisch verarbeitet – wohl erstmals in Weihnachtsabend. Die zehnte Strophe dieses Gedichts (»[…] Der Verlorne naht sich wieder; / Geh mit ihm nicht ins Gericht.«) passt zwar besser zur Situation des Straftäters und Häftlings May in der zweiten Hälfte der 1860er Jahre; die meisten anderen Strophen aber dürften zugleich die Gemütsverfassung des neunzehnjährigen Schullehrers im Untersuchungsgefängnis zu Chemnitz spiegeln.
Der fünften Strophe des Weihnachtsgedichts ist eindeutig zu entnehmen: Während »unten« in der Stadt, außerhalb der Gefängnismauern, mit großen Gefühlen und innigster Freude das Christfest, der Heilige Abend gefeiert wird, muss »droben« in seiner Zelle der Gefangene eine existenzielle Einsamkeit und eine schreckliche Dunkelheit ertragen:
»Unten zieht des Festes Freude
Jetzt in alle Herzen ein;
Droben ist mit seinem Leide,
Seinem Grame er allein.«
Welchem »Leide«, welchem »Grame« Karl May über Weihnachten 1861 ausgeliefert war, liegt auf der Hand. Er war offenkundig das Opfer einer Intrige und wird sich so gefühlt haben wie die Romanfigur Karl Sternau im Kapitel ›Die Weihnacht des Gefangenen‹ im Kolportagewerk Waldröschen: »Es war der heilige Christabend. […] Es brach die Stunde an, an welcher sich Diejenigen, welche sich lieben, beschenken. Sternau dachte der Seinen; er dachte an Rodriganda und – er weinte, weinte wie ein Kind.«
Wahrscheinlich hat der neunzehnjährige Karl May am Heiligen Abend 1861, im Untersuchungsgefängnis zu Chemnitz, geweint. In jedem Fall war er sehr traurig. Gewiss hatte der Gefangene Mitleid mit seinen Eltern, seinen Geschwistern, seiner geliebten ›Märchengroßmutter‹. Auch Selbstmitleid wird, verständlicherweise, mit im Spiel gewesen sein. Und vermutlich kamen – was das Weihnachtsgedicht freilich nicht erkennen lässt – auch eine gehörige Portion Wut und Zorn hinzu.
In Mein Leben und Streben berichtet May von Rachegedanken, von inneren »Stimmen«, die sehr mächtig in ihm wurden: »Die Hauptsache war, daß ich mich rächen sollte, rächen an dem Eigentümer jener Uhr, der mich angezeigt hatte, nur um mich aus seiner Wohnung loszuwerden, rächen an der Polizei, rächen an dem Richter, rächen am Staate, an der Menschheit, überhaupt an jedermann!« Ziemlich bitter, aber nicht ohne Selbstironie fügt Karl May hinzu: »Ich war ein Mustermensch, weiß, rein und unschuldig wie ein Lamm. Die Welt hatte mich betrogen um meine Zukunft, um mein Lebensglück.«
Ob diese – der Verzweiflung nahe – psychische Verfasstheit, ob diese bedrohliche ›Seelenfinsternis‹ schon am Heiligen Abend 1861 oder erst in späteren Monaten und Jahren den jungen Karl May beherrschte, können wir nicht mit Sicherheit klären. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass May schon während der Untersuchungshaft in Chemnitz, also zu Weihnachten 1861, mit dem Aufkommen einer schweren Depression zu kämpfen hatte. Mays Glaube an die Frohe Botschaft, die im Weihnachtsgedicht immer wieder anklingt (»Ich verkünde große Freude, / Die Euch widerfahren ist, / Denn geboren wurde heute / Euer Heiland Jesus Christ!«), dürfte sich vermischt haben mit abgrundtiefer Traurigkeit und zugleich mit chaotischen Emotionen, mit Hass- und Rachegedanken.
Wie passt das zusammen? Das menschliche ›Ich‹ ist ein kompliziertes Gebilde. Die »sogenannte Spaltung des menschlichen Innern« ist ja nicht nur ein psychiatrisches Thema; vielmehr ist der Zwiespalt, das Hin- und Hergerissensein zwischen unterschiedlichen, teils sogar gegenläufigen Strömungen innerhalb der eigenen Seele ein allgemeines Menschheitsthema.
Starke, sich u. U. auch heftig widersprechende Gefühle entstehen vor allem dann, wenn ein Mensch aus seiner Bahn geworfen wird. Die Verhaftung und die ungerechte Gefangenschaft hatten – so heißt es in Mays Selbstbiographie Mein Leben und Streben – »wie ein Schlag auf mich gewirkt, wie ein Schlag über den Kopf, unter dessen Wucht man in sich selbst zusammenbricht. Und ich brach zusammen! Ich stand zwar wieder auf, doch nur äußerlich; innerlich blieb ich in dumpfer Betäubung liegen; wochenlang, ja monatelang. Daß es grad zur Weihnachtszeit geschehen war, hatte die Wirkung verdoppelt.«
»O du fröhliche, o du selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit!« Doch ausgerechnet in der Weihnachtszeit nehmen Depressionen und depressive Verstimmungen bekanntlich zu – weil gerade zu dieser Zeit unsere Gefühle und unsere Erwartungen besonders hochgeschraubt sind.
Karl May jedoch blieb in der ›Seelenfinsternis‹ nicht stehen. Er erhob sich aus der Dunkelheit und zündete, literarisch, ein Licht an. Als Christ und als Schriftsteller verkündete er seinen Leserinnen und seinen Lesern:
»Darum gilt auch dir die Freude,
Die uns widerfahren ist,
Denn geboren wurde heute
Auch dein Heiland Jesus Christ.«
Pfarrer Hermann Wohlgschaft
Wir wünschen allen unseren Internetbesuchern ein frohes Weihnachtsfest und ein friedvolles Jahr 2025!
Reisen
zu Karl May – Leben, Werk, Erinnerungsstätten
In Zusammenarbeit mit der Karl-May-Stiftung Radebeul bei Dresden